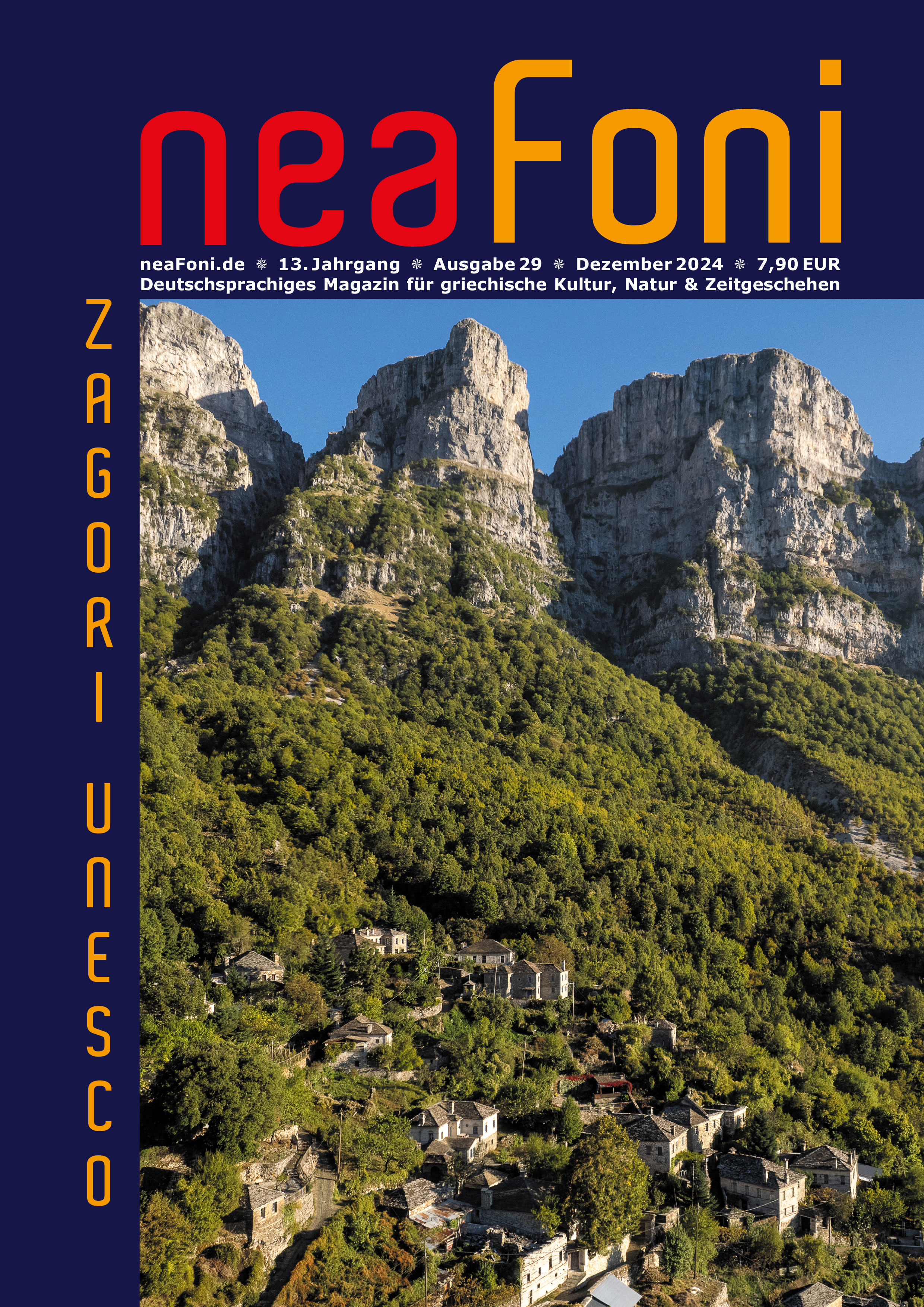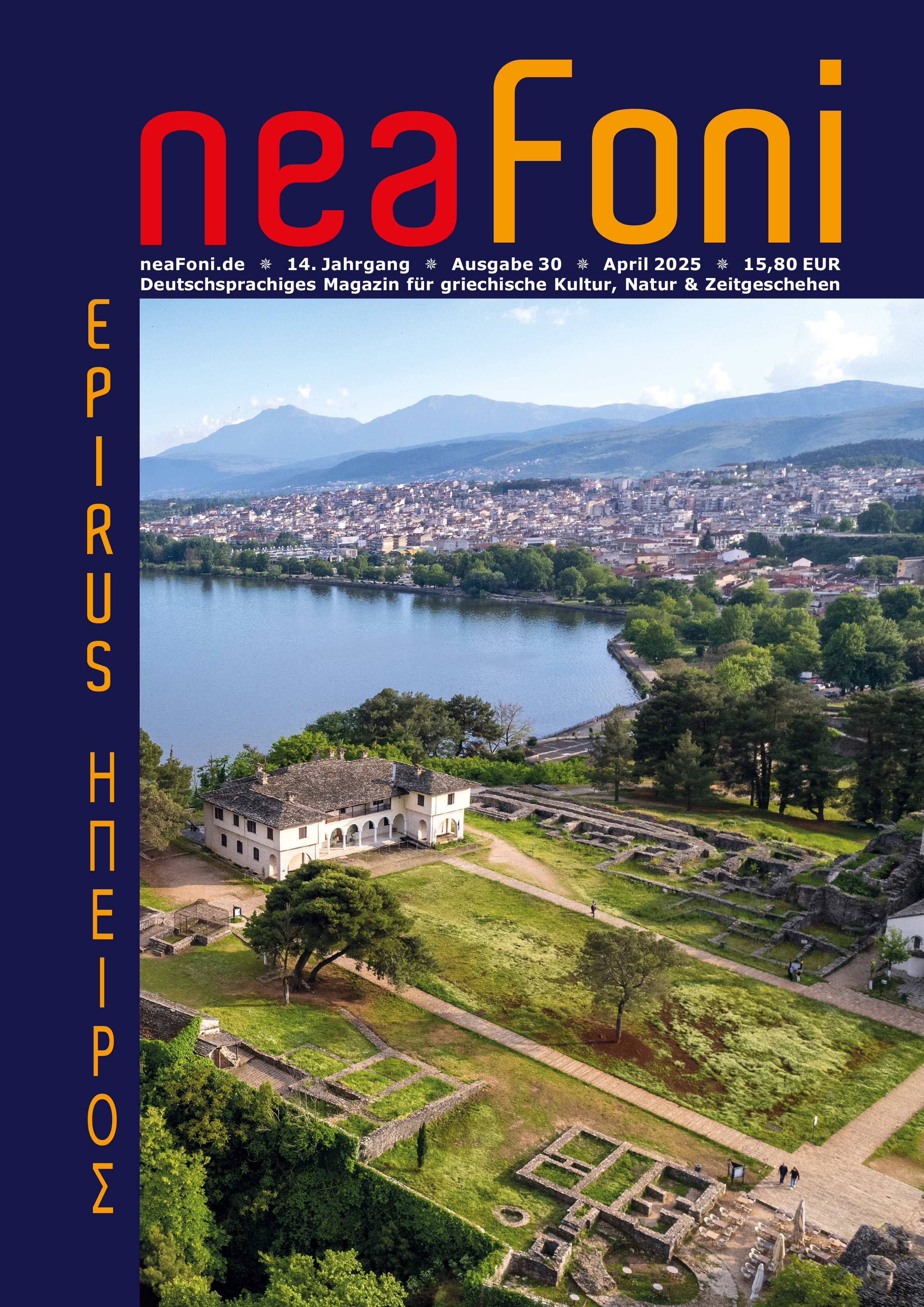Im Jahre 1453 erobern die Osmanen Konstantinopel und 1458 Athen. Fast 400 Jahre lang werden die Griechen unter osmanischer Herrschaft stehen. Erst im Verlauf des 18. Jahrhunderts, als die Zeichen des Verfalls des Osmanischen Reiches deutlich zu erkennen sind, bringt der Handel von Kaufleuten griechischen Ursprungs oder griechischer Kultur nicht nur ökonomisches Wachstum, sondern auch Kontakte zur westlichen Welt. Neben der religiösen Identität entwickelt sich langsam auch die nationale, die das Verlangen nach Freiheit verstärkt.
Der Unabhängigkeitskrieg gegen das Osmanische Reich begann am 25. März 1821 auf der Peloponnes. Kaum unterstützt von den europäischen Großmächten erkämpft sich Griechenland seine Freiheit: Der unabhängige griechische Staat, der die Peloponnes, die Süd-Rumeli und die nahe des Festlandes liegenden Inseln (Sporaden, Kykladen, Evia, Inseln des Saronischen Golfes) umfasst, wird 1830 mit dem London-Abkommen anerkannt. Die Wahl des Monarchen müssen die Griechen den Großmächten überlassen: Sie bestimmen den 17-jährigen Sohn des Königs Ludwig I. von Bayern, Otto von Wittelsbach, zum ersten König Griechenlands.
Die Wiederentdeckung Griechenlands im 19. Jh. - Berichte von Zeitzeugen
Als die Herrschaft der Türken schon ihrem Ende zuging, am Anfang des 19. Jahrhunderts, trat Griechenland wieder in den Gesichtskreis Europas. Gewiss, die Antike war lebendig geblieben im Mittelalter, stärker noch seit der Renaissance. Das Interesse übertrug sich aber nicht auf das Land: Das lag abseits der großen west-östlichen Handelsstraßen und auch abseits der Routen, die in das Heilige Land führten.
Wodurch trat die Wende ein?
Von 1751 - 1754 hatten zwei Engländer, der Architekt und an Archäologie interessierte James Stuart (1713 - 1788), und der Architekt und Maler Nicholos Revett (1720 - 1804) Griechenland bereist. Ihre Studien hatten sie in Wort und Bild zwischen 1762 und 1790 in mehreren Bänden in London veröffentlicht. Der Titel ihres Werkes lautete: „The Antiquities of Athens.“
Zur gleichen Zeit machte ein weiterer Engländer von sich reden: Richard Chandler. Er war Mitglied der Londoner Altertumsgesellschaft und promovierter Theologe. 1776 erschien - ebenfalls in London - sein Buch „Travels in Greece“, das noch im gleichen Jahr von Heinrich Voß ins Deutsche übersetzt wurde: „Reisen in Griechenland“.
Es waren Engländer, die als erste die griechische Antike wiederentdeckten. Bereits 1715-25 hatte Alexander Pope eine englische Übersetzung der homerischen Epen vorgelegt. Erst 60 Jahre später, 1778, erschien eine erste deutsche Homerübersetzung von Leopold von Stolberg. Kurze Zeit später, 1781 - 93, folgte die noch heute gern gelesene Ausgabe von Heinrich Voß, eben jenem Voß, der kurz zuvor Chandlers Griechenlandbuch übersetzt hatte.
Es was das England des 18. Jahrhunderts, in dem man sich zuerst nach dem Ursprünglichen zurücksehnte und die als künstlich empfundene Kultur des Barocks sprengen wollte. Der „Englische Garten“ ist ein Ausdruck des neuen Verhältnisses zur Welt, in dem die Natur nicht mehr unterjocht, sondern als lebendiges Gegenüber empfunden werden sollte und in dem die Ruine als „Denkmal des Vergangenen und der Vergänglichkeit“ (Richard Benz) ihren Platz hatte.
In Deutschland erschien 1764 Johann Joachim Winkelmanns (1717 - 1768) „Geschichte und Kunst des Altertums“ mit dem berühmten, von Pope inspiriertem Diktum der „edlen Einfalt und stillen Größe“, die er der antikgriechischen Kunst attestierte, ganz im Gegensatz zu dem an den Fürstenhöfen gepflegten Stil des Rokoko.
Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778) hatte zuvor das Primitive, Ursprüngliche, Einfache als das Natürliche, Wertvolle und Erstrebenswerte gepriesen. In diesem Sinne verwendet Winkelmann den Begriff der „Einfalt“. Als „groß“ galten ihm die Griechen, weil die Zivilisation sie noch nicht klein gemacht hatte. Hatte man sich bis jetzt fast ausschließlich an der römischen Architektur orientiert und lediglich die Hagia Sophia im einstigen Konstantinopel als hervorragende griechische Leistung bewundert, und waren auch Goethe 1787 beim Anblick der dorischen Tempel in Pästum „die stumpfen, kegelförmigen, eng gedrängten Säulenmassen lästig, ja furchtbar“ erschienen, so fand man jetzt gerade alles Römische überladen (Baumstark, a.a.O., S.161-65).
Seit 1816 - mehr als 50 Jahre nach der Veröffentlichung von Winkelmanns Kunstgeschichte - konnte man endlich griechische originale Skulpturen außerhalb Griechenlands bewundern. Der zweifelhafte Ruhm, dieses ermöglicht zu haben, kommt Thomas Bruce Lord Elgin (1766 - 1841) zu, wiederum einem Engländer also, genauer: einem Schotten. In diesem Jahr kaufte der englische Staat dem Lord alle Antiken ab, die dessen Beauftragte in den Jahren 1801 - 1804 von der Akropolis abtransportiert hatten, ganz legal übrigens, denn Elgin, der von 1799 - 1803 englischer Gesandter bei der Hohe Pforte war, hatte sich von dem Sultan mit einer umfassenden Vollmacht ausstatten lassen. In ihr hieß es u.a. „und wenn Sie irgendwelche Steinfragmente mit Inschriften oder Figuren darauf mitzunehmen wünschen, dass man ihnen dabei keine Schwierigkeiten bereite...“ Ob sich das freilich auch auf Friesplatten bezog, die noch fest im Bau verankert waren, unterliegt berechtigtem Zweifel. Die politische Situation begünstigte Elgin. Hatten die Engländer doch gerade die Franzosen aus Ägypten vertrieben und bei den Türken die Hoffnung genährt, sie würden ihre alte Provinz zurückerhalten. Das erklärt die Großzügigkeit des Sultans - unter anderem. Wir kommen darauf zurück.
1810 hatte sich schließlich auch eine Gruppe Deutscher von Rom aus auf den Weg nach Athen gemacht. Zu ihr gehörten: Der Architekt und Archäologe Carl Freiherr Haller von Hallstein (1774 - 1817), Otto Magnus Baron von Stackelberg (1787 - 1837), der Maler Jacob Linckh (1787 - 1840) sowie zwei Dänen. Linckh hat Tagebuch geführt, von Stackelberg ist schon sehr bald mit einer Reihe von Werken an die Öffentlichkeit getreten. (Costumes et usages des peuples de la Grèce moderne“, Bd I: Rom 1825, Bd II: Berlin 1837, Deutsch “Bilder aus dem Leben der Neugriechen”, Dresden 1884; „Der Apollontempel zu Bassai in Arkadien und die daselbst gefundenen Bildwerke”, Rom 1826; „La Grèce, vues pittoresques et topographiques“, Paris 1829/38; „Die Gräber der Hellenen“, Berlin 1837.
Dieser Gruppe gelingen zwei große Entdeckungen: Sie bringen Giebelfiguren des Aphaiatempels auf Aigina, die berühmten Ägineten, und den Fries des Apollontempels in Bassai ans Licht. Griechenland war wieder in den Horizont der Europäer gerückt und von nun an, zumal seit der von den Großmächten anerkannten Unabhängigkeit 1830 und dem Beginn der Epoche der Bayernherrschaft 1832, sollte der Strom der Reisenden nicht versiegen, wobei die Motive durchaus unterschiedlich waren. Was Reiseführer anging, musste man auf die Antike zurückgreifen. Man vertraute sich seinem Pausanias an, einem gelehrten Reiseschriftsteller des 2. Jahrhunderts. 1840 kam dann ein erster moderner Reiseführer auf den Markt. Auf den ersten „Baedeker“ musste man allerdings noch bis 1883 warten.
So gerüstet, begeben wir uns in das Griechenland der ausgehenden Türken- und der beginnenden Bayernherrschaft.
„Welch Bild der Verwüstung.“ Über den Zustand der antiken Stätten
Wir kommen mit Ludwig Ross, der 1834 Oberkonservator der Altertümer in Athen wurde und von 1837 - 1843 Archäologie und Philologie an der Neugegründeten Otto-Universität in Athen lehrte, 1832 in Athen an:
„Ein paar Pferde trugen unser Gepäck. Wagen, selbst Karren, gab es damals in ganz Griechenland nicht, außer in Nauplia und Argos... Athen war unter der türkischen Herrschaft bis zum Ausbruch der griechischen Aufstanden ein Städtchen 6000 - 8000 Einwohnern gewesen, weitläufig mit engen und krummen Gassen, mit Gärten und Hofräumen...
Welch ein Bild der Verwüstung! Fast wie ein elender Trümmerhaufen, niedrige, halb eingerissene, zum Teil notdürftig wieder ausgeflickte Wohnungen, von den stolzen Resten des Altertums, von einigen zerstörten Kirchen und Moscheen und von wenig besser erhaltenen Häusern... und einem Dutzend vereinzelter schlanker Palmen und Cypressen überragt. Mühsam wanden sich unsere Lasttiere durch die engen Gassen zwischen dem Gemäuer alter und neuer Zeiten, über Schutthügel hin.“ (Ludwig Ross, a.a.O., S. 28/30)
Der erste Besuch gilt der Akropolis. Wie es dort aussah, entnehmen wir der Schilderung Richard Chandlers aus dem Jahr 1776: „Die Akropolis... ist nun eine Festung mit einer dicken unregelmäßigen Mauer... Die Garnison besteht aus wenigen Türken, die mit ihren Familien da wohnen und von den Griechen Kastriani oder Schlosssoldaten genannt werden. Ihre Häuser sehen über die Stadt, die Ebene und den Busen weg, und die Lage ist angenehm, aber zu sehr der Luft ausgesetzt und mir so vielen Unbequemlichkeiten begleitet, dass diejenigen, die es können, wenn sie die Wahl haben und nicht im Dienst sind, lieber unten wohnen.
...An trinkbarem Wasser ist Mangel und täglich wird, auf Pferden und Eseln, in steinernen Krügen aus einer der Wasserleitungen in der Stadt der nötige Vorrat hinaufgebracht.“ (zitiert in Hautumm (Hg.), a.a.O., S. 55)
1810/11 notierte Stackelberg: „Auf alle Weise ward der Eingang zur Burg befestigt und verschanzt. Sogar auf den Propyläen standen Kanonen und allabendlich nahm ein Archont die Schlüssel der Tore in Verwahrung.“
Wie der Parthenon so waren auch die Propyläen bei der Belagerung von 1687 beschädigt worden. Auch hier war Pulver gelagert, das Dach war fortgerissen worden. Die Türken hatten die Räume zwischen den sechs dorischen Säulen des Eingangs zugemauert, die Kapitelle der Säulen abgeschlagen und Kanonen aufgestellt.
Stackelberg fährt fort: „Man geht um den Prachtbau herum bis zu einem vierten Tor, durch welches die Akropolis betreten wird. An Stelle der Statuen und Denkmäler standen eine Menge kleiner Baracken. In der Mitte der Burg erhebt sich ihre schönste Zierde - der alles überragende Parthenon, dieses Säulenhaus der Göttin Athene. Auf dem weißen Marmorboden hatten die Türken eine Moschee erbaut, die Auge und Phantasie des Künstlers beleidigte...
Ohne Verbindung mit dem Chaos des Tempels, dessen Trümmer wie hingesät am Boden lagen, stand nur noch eine Säulenreihe vom Seitenportikus...
An den Fronten der Abendseiten sahen wir Überbleibsel der Statuen. Die Basreliefs des Frieses waren voll Leben und wunderbar schön in der Feinheit ihrer Behandlung...
Gänzlich verstümmelt waren die Metopen. Was sich noch einigermaßen erhalten, hob Lusieri mit großer Mühe heraus und schickte es nach London in das Kabinett Lord Elgins. So ward der heilige Ort all seiner Schätze beraubt. Die größten Meisterwerke der Plastik sind in’s ferne Nebelland gebracht, weit fort von dem Licht und der Wärme, die sie entstehen sah.
Jetzt gleicht die Akropolis einem ungeheuren Trümmerfeld, das sich die kleinen Türkenbuben zum Spielplatz erwählt haben, wo sie mutwillig die schönen Bruchstücke vollends zerschlagen. Fast scheint es unglaublich, wie die Menge der umherliegenden Marmorblöcke noch nicht aufgebraucht ist, da der feinkörnige Stein schon seit vielen Jahren zum Kalkbrennen verwandt wird. Beim Anblick dieser Zerstörung erfasste uns Wehmut und Trauer. Solcher Unfug auf der Stätte des Phidias und Perikles zum geistigen Mittelpunkt Griechenlands erhoben, ist eine Schmach für das Volk!
Auf der anderen Seite der Burg lag das Erechtheum, des attischen Helden Erechtheus Heiligtum. Es war beinahe vollständig zerstört, nur eine Wand und ein paar Säulen standen noch zwischen Schutt und Trümmern. Das Pandroseion war verbaut, die Karyatiden der Vorhalle in rohe Wände vermauert, eine von ihnen nach London in Lord Elgins Sammlung gebracht.“ (Hans Haller von Hallerstein: a.a.O., S. 64/65)
Über das Erechtheion berichtet Ludwig Ross (a.a.O., S. 157, Anmerkung) folgende Geschichte, die sich im Befreiungskampf der Griechen zugetragen hat: „Der griechische General Gouras, welcher während der Belagerung durch die Türken auf der Akropolis befehligte, hieß seine Frau und seine Kinder in das Erechtheion bringen und die Decke desselben, um es noch bombenfester zu machen, eine Elle hoch mit Erde überschütten. Die Türken, welche dies erfuhren, richteten ihr Geschütz von Areios Pagos aus vorzüglich auf die ...nordwestlichen Säulen des Tempels, bis diese einstürzten und die Familie des Gouras unter der nachstürzenden Steinmasse begruben, wo ihre Gebeine noch ruhen.“
Starben im Parthenon Türken, so im Erechtheion Griechen. Wer heute die Tempel besichtigt, macht sich nicht klar, dass sie nicht nur mit wechselvoller Geschichte gesättigt sind, sondern auch Leid bergen.
Zwischen den antiken Ruinen war ein türkisches Dorf entstanden. Die Häuser waren zum großen Teil aus dem Material der alten Bauwerke errichtet worden. Die hohen türkischen Würdenträger hatten ihre Paläste, die sogar über kleine Gärten verfügten, mit hohen Mauern umgeben, um ihre Frauen vor fremden Blicken zu schützen. Wenn interessierten Athenbesuchern verboten wurde, Gerüste zu besteigen, um Skulpturen im Fries oder in den Giebeln genauer studieren zu können, so deshalb, weil man von oben in die Höfe und Fenster hineinschauen konnte.
Die Theater des Dionysos und des Herodes Atticus sind ganz mit Erde gefüllt. Sie dienten als Getreideäcker. (L. Ross, a.a.O., S. 155).
Vom Aeropag berichtet Ross, er habe „jetzt eine seltsame Bestimmung.“ „Da nämlich auch die Moscheen mit ihren Türmen zerstört sind, haben die Türken auf diesen Hügeln eine kleine Steinhütte für einen halbwahnsinnigen Derwisch erbaut, der von hier aus die Stunden des Gebets verkündet. Am Tage verhallt sein Ruf fast unbemerkt, aber am Abend ist er mir oft wie eine gespenstische Erscheinung vorgekommen, wenn er im Mondlicht, bis an den äußersten Rand des Felsens vorschreitend, die Arme mit langen faltigen Gewändern wunderlich durch die Luft bewegt und seine tiefe, klagende Stimme weithin erschallen lässt, nicht unähnlich einem gewaltigen Zauberer, der die finsteren Geister der Nacht heraufzubeschwören gedenkt.“
Ähnlich bizarr ist die Überlieferung, demzufolge sich im Mittelalter ein Säulenheiliger auf einer Säule des Tempels des olympischen Zeus in einer kleinen Hütte häuslich eingerichtet habe.
Über den Ruinen von Delphi war das kleine türkische Dorf Kastri entstanden. Ernst Curtius schildert es 1837: „Die Häuser von Kastri liegen gerade auf dem alten Tempel des pythischen Apollon, dessen mittägliche Stufe von schimmerndem pentelischem Marmor zwischen den Hütten durchscheint. Ebenso entdeckt man zwischen zwei ärmlichen Hütten einen Teil der prächtigen Theaterrundung und überall Spuren von Tempelresten und beschriebenen Marmorblöcken.“ (Heinrich Alexander Stoll, Gerhardt Löwe (Hg.), a.a.O., S. 367/368)
Kein Wunder, dass die Einwohner von Kastri nicht sehr begeistert waren, wenn neugierige Fremde auch unter dem Niveau ihrer Häuser zu wühlen begannen: „Aber schon an diesem Tage waren die Arbeiten sehr gestört worden durch das Geschrei der Weiber (und die Delphierinnen haben gute Lungen) aus den benachbarten Häusern, die für ihre Wohnungen alle möglichen Gefahren von dieser Umwühlung des Bodens befürchteten und sich nicht dadurch beruhigen ließen, dass ich erklärte, alles wieder ebnen lassen zu wollen. Der Hauptgrund war eigentlich, dass das Volk von Kastri die Meinung hat, dass hier große Schätze verborgen seien, die es ganz selbst und ganz im Geheimen haben möchte”. (C.O. Müller, in: H.A. Stoll, g. Löwe (Hg.), a.a.O., S. 232)
„Wer das Theater in Epidaurus kennt, wird sich schwerlich vorstellen können, dass es ganz mit dichtem Buschwerk und vereinzelten schönen Bäumen überwachsen (war), sodass die aufbauende und erfassende Phantasie stark angeregt wurde, die verbindenden Linien zu finden und die schönen Verhältnisse sich lebendig zu machen, die man berechtigt war, von einem schon im Altertum berühmten Bau des jungen Polyklet zu erwarten.“ (1875/76) (Friedrich Carl von Duhn in H.A. Stoll/G. Löwe (Hg.), a.a.O., S. 399)
Wie es in Korinth aussah, erfahren wir aus einem Reisebericht des Jahres 1876: „Die Mitte der Ortschaft bildet eine Verflachung, hinter welcher mitten im Getreidefelde die 7 verkehlten dorischen Säulen stehen, die dürftigen Reste des Tempels. ...Die Säulen sind fast der einzige nennenswerte Überrest des alten Korinth. In der unmittelbaren Umgebung findet man noch Trümmerwerke, elende Zeugen vergangener Größe. Jetzt sieht man dort Kinder albanesicher Zunge auf den Ruinen des Altertums fröhlich tanzen.“ (Eine Spazierfahrt im Golfe von Korinth, Prag 1876, S. 172 f.)
Von Olympia zeichnet Hölderlins Hyperion ein geradezu idyllisches Bild: „Ach, die ausgestorbenen Tale von Elis und Nemea und Olympia, wenn wir da an eine Tempelsäule des vergessnen Jupiters gelehnt, umfangen von Lorbeerrosen und Immergrün, ins wilde Flussbett sahen - ... da saß ich traurig spielend neben ihm (Adamas) und pflückte das Moos von eines Halbgottes Piedestal, grub eine marmorne Heldenschulter aus dem Schutt und schnitt den Dornbursch und das Heidekraut von den halbbegrabenen Architraven.“ (a.a.O., S. 15)
Forschen - Reisen - Graben
Vielfach waren Abenteuerlust, Neugier, der Wunsch, bekannt und bewundert zu werden, die Motive, die Reisende nach Griechenland lockten. Mehr und mehr schlichen sich Goldgräbermentalität und Geldgier ein. Sie wuchsen in dem Maß, in dem sich ein Markt für Antiken öffnete. Daneben gab es natürlich immer auch diejenigen, die das reine Interesse antrieb, die Antike zu studieren. Zu ihnen gehörte, um mit ihnen zu beginnen, der Göttinger Professor für Altertumswissenschaft, Carl Ottfried Müller, der 1839/40 ein Forschungsstipendium für eine Reise nach Griechenland nutzte. Wir kennen den Verlauf aus Briefen, die er an seine Frau in Deutschland schrieb. Vom 26. Juli 1840 stammt sein letztes Lebenszeichen, wenige Tage später starb er in Athen. Über seinen Tod berichtet ein Reisebegleiter, Ernst Curtius, an seine Eltern. Curtius war damals 26 Jahre alt, ein Schüler Müllers, später sein Nachfolger auf dem Lehrstuhl in Göttingen. Er war unter anderem Erzieher des späteren Kaisers Friedrich.
Nun zu dem Brief. Er ist ein erinnerungswürdiges Monument eines von seiner Sache begeisterten Gelehrten. „Die ersten Tage des delphischen Aufenthaltes mit ihren reichen, überaus pünktlichen Erfolgen waren die letzten hellen Tage seines Lebens. Er ließ die ganze Mauer (es handelt sich um die Polygonalmauer, die den Unterbau des Tempels bildet) in ihrer Steinfügung von Neise zeichnen, die einzelnen Steine und Inschriften wurden nummeriert und registriert, und wir drei (Müller, Curtius, Dr. Schöll), begaben uns jetzt ans Werk, diese noch ganz unbekannten Inschriften zu entziffern und niederzuschreiben. Des Abends wurde das Geschriebene verglichen und besprochen, die Lücken ergänzt und das Zweifelhafte zu einer neuen Besichtigung der Inschrift angestrichen. So arbeiteten wir ein paar Tage fort. Die Ausgrabung der Mauer war bis zum Ende vorgerückt. Der Eckstein selbst war in dem Graben liegend und bei gänzlichem Mangel an Hebeinstrumenten nicht gut fortzuschaffen. Müller hatte interessante Anfänge auf diesem Stein gefunden und ließ es sich nicht ausreden, selbst den ganzen Stein zu kopieren. Zu diesem Zweck musste er lange in der unbequemsten, gebückten oder liegenden Stellung schreiben. Ich bat ihn drei-, viermal um die Erlaubnis, ihn abzulösen, aber er wollte dies nicht und vollendete auch die Abschrift, fühlte sich aber gleich darauf so erschöpft, dass mir damals zuerst um ihn bange war. Nachdem er den ganzen Tag geruht hatte... kam er den folgenden Tag wieder zu den Inschriften. Ich blieb ihm zur Seite und bemerkte bald, dass er gleich nach den ersten Leseversuchen schwindlig wurde, sodass ihm sein Buch aus den zitternden Händen fiel. Von der Zeit an gab er das Schreiben ganz auf...“ (zitiert in: H.A. Stoll, G. Löwe (Hg.), a.a.O., S. 372/73)
Andere, weniger Forscher als Genießer, reisten auf den Spuren des Mythos oder der antiken Autoren. Der Fürst Hermann Pückler-Muskau war einer von ihnen. 1836 war er - übrigens in orientalischem Kostüm - in Griechenland unterwegs. Er hat in England den Landschaftsgarten entdeckt und ihn dann in Deutschland heimisch gemacht: ein Antiklassizist und Kenner der Antike zugleich.
Zu Pferd unterwegs zwischen Megara und Korinth bemerkt er: „Die Kakiskala (üble Treppe) ist eine nicht ganz gefahrlose Passage, auf der schon mehrere Unglücksfälle stattfanden; überdies scheuen die Pferde leicht vor dem hohlen Brausen der See in den senkrechten Abgründen unten und den jählingen Windstößen oben, die aus des Felsenschlünden unerwartet hervordringen. Von einem solchen umgeworfen, würde man schnell in der Tiefe ankommen, da die skironischen Felsen so glatt poliert sind. Noch jetzt nennt man diesen Stoßwind, den auch Seefahrer an der Küste fürchten, Skiron, und wahrscheinlich gab er Gelegenheit zu der Fabel vom Räuber Skiron, der die Wanderer hier ins Meer hinabwarf, so dass Theseus’ Besiegung des Skiron sich vielleicht auf eine bloße Verbesserung der Straße und passend angebrachte Schutzmauern beschränkte.“ (Fürst von Pückler-Muskau, a.a.O., S.206)
Da betätigt sich der Fürst als Entmythisierer: Hatten doch die Athener ihren Held Theseus dem peloponnesischen Herakles als ebenbürtig an die Seite stellen wollen, indem sie ihm die Beseitigung dieser Unholde zuschrieben. Des Skiron, der die Wanderer zwang, ihm die Füße zu waschen, und sie dabei mit einem Fußtritt ins Meer stürzte; des Sinis oder Pityokamptes, der die Wanderer an zwei herabgezogene Fichtengipfel band, die Bäume dann emporschnellen und so zerreißen ließ; und des berüchtigten Prokrustes: Er legte die Wanderer in sein Riesenbett und dehnte sie so lange, bis sie hineinpassten. Nun hatte Theseus nicht heldenhaft gekämpft, sondern nur für die Verbesserung des Weges gesorgt. Die Skepsis gegenüber dem Mythos hinderte Pückler freilich nicht, fest an die Realität all dessen zu glauben, was Homer beschreibt.
Als er am Meeresufer der Insel Ithaka steht ist ihm „in Gedanken gegenwärtig, als Ulisses schlafend, mitsamt seinem Bette, das, wie noch jetzt in diesen Ländern üblich, aus einem Teppich bestand, auf die sandige Küste von den Phäaken gezogen wird, welche seine Schätze neben ihn hinstellen. Ich sehe ihn erwachen, der sein Vaterland nicht wieder erkennt, höre ihn dann inbrünstig Zeus anflehen, und als Minerva in Gestalt eines Fischerknaben erscheint, dieser mit gewohnter List sogleich eine schnell erfundene Fabel erzählt, bis die erhabene Göttin Minerva mit den leuchtenden Augen sich zu erkennen gibt und ihm lächelnd seinen Mangel an Wahrhaftigkeit vorwirft, mit dem er selbst den unsterblichen Göttern etwas weiszumachen versuche.“
(a.a.O., S. 354/355)
Und nun begleitet er Odysseus zu der Grotte, in der er seine Gastgeschenke versteckt, weiter „durch schwierige Pfade, über kahle Höhen und längs schroffer Abgründe“ zu dem treuen Schweinehirten Eumaios (S. 357), und findet, dass „Homers Beschreibung der Gegend an dieser Stelle... mit der Wirklichkeit ziemlich überein(stimmt).“ (S. 358) Es tut nichts zur Sache, dass man inzwischen unsicher ist, ob die Insel, die damals Ithaka hieß und heute so heißt, mit der Heimat des Odysseus identisch ist. Manche meinen, es sei eher die benachbarte Insel Kephalonia.
„Homers Gesänge sind es, die diesen stummen Männern (von Mykene) die Weihe des Ruhms geben, und diesen Mauern wiederum sind die wahrhaftigen Zeugen Homer’s, sie beweisen uns, dass es einen Agamemnon gegeben hat und viele Tapfere vor ihm.“
(a.a.O., S. 211) notiert Hermann Hettner am 21. April 1852 in sein Tagebuch.
Zu der Gruppe derer, die in den Spuren Homers und des antiken Baedeckers, des Pausanias, aus dem 2. Jahrhundert n. Chr., folgten, gehörte auch Heinrich Schliemann. 1876 begann er mit seinen Grabungen in Mykene, 5 Jahre nach dem ersten Spatenstich in Troja. Er brauchte sich nicht mit dem Anschauen zu begnügen, er hatte Geld und Ehrgeiz, er konnte und wollte graben. Sein Charakterbild schwankt in der Geschichte. Kaum jemand wird so ambivalent beurteilt wie er. Er ist ein Forscher und Schatzsucher. Er entdeckt die Tradition, und verwertet sie. Er ist ein Träumer und Realist. Er stellt sich in den Dienst der archäologischen Wissenschaft, und er stellt die archäologische Wissenschaft in den Dienst des Mythos.
Ein Jahr, bevor Schliemann nach Mykene kam, im Jahre 1875, hatte das Deutsche Reich einen Vertrag mit dem Königreich Griechenland geschlossen, der einen Wendepunkt der Archäologie markierte: Das deutsche archäologische Institut erhielt die Erlaubnis, in Olympia zu graben, und verpflichtete sich zugleich, alle Funde nicht nur in Griechenland zu belassen, sondern sie auch an ihrem Fundort auszustellen. Dieser Vertrag wurde richtungweisendes Vorbild.
Die Jagd nach Antike
Wenden wir uns von denen ab, die sich für die Antike interessierten, und denen zu, denen es mehr die Antiken angetan hatten. Lord Elgin war nur einer von ihnen, allerdings einer der schlimmsten. Hat er doch nicht nur - wie andere - Kunstwerke ausgegraben, sondern sie auch aus ihren noch intakten Bauwerken loslösen lassen.
Dodwell hat die Reaktionen der Menschen registriert, deren Ohrenzeuge er in Athen geworden ist: „Es ist durchaus unmöglich, die Gefühle des Unwillens zu unterdrücken, die in der Brust eines jeden Reisenden sich erheben müssen, wenn er diese Tempel vor und nach jener britischen Zerstörung erblickt! Auch kann ich nicht umhin, hier der Welt mitzuteilen, dass nicht allein die Griechen, sondern selbst die Türken sogar den Ruin der Verwüstung, der hier verübt ward, innigst fühlten und beklagten; dass sie laut und öffentlich ihren Großherrn sehr hart darüber tadelten, dass er dazu je seine Einwilligung gegeben. Ich fand mich zu derselben Zeit an Ort und Stelle... Das ganze Unternehmen war in Athen so unpopulär, dass man den Arbeitsleuten das doppelte Taglohn, als gewöhnlich war, bezahlen musste, ehe man es dahin brachte, dass sie Hand ans Werk legten...
Es bleibt eine unbestreitbare Tatsache, dass die prächtigen Monumente der Akropolis zu Athen während des einzigen Verwüstungs- und Raubjahrs 1801 durch Elginsche Unternehmung mehr gelitten, als während des ganzen zunächst vorhergegangenen Jahrhunderts.“ (a.a.O., 2.Bd., S. 133/134)
War denn nun einmal mit dem Zerstörungswerk begonnen, hatte man keinerlei Skrupel, es fortzusetzen. So schreibt der Kronprinz Ludwig von Bayern in dem ihm eigenen Stakkato-Deutsch an den Baron Haller von Hallersleben in einem Brief von 1816 nach Athen unter anderem folgendes: „Mein lieber Baron! ...Wenn Sie mir aus Athen von dem Pandrosion 1 Kariathide, lieber noch 2, wenn dieses ohne des Gebäudes Schaden geschehen kann, erwerben könnten, würde mich freuen; und sollte dies nicht ohne Geschenke von den türkischen Obrigkeiten zu bewirken, mit der Vorstellung begleitet, dass das Werk doch nicht mehr ganz besteht, da Lord Elgin eine Kariathide hinweggeführt, und eine demnach bliebe, wenn ich auch zwei bekäme, da nicht mehr alle vier, es schon kein Ganzes mehr bilde.“ (Hans Haller von Hallersleben, a.a.O., S. 267/68)
Zu seiner Ehre sei hinzugefügt, dass er, durch Hallers Vorhaltungen bewogen, auf die Erfüllung seiner Bitte verzichtet hat.
Auch nach 1833, als bayrische Truppen die Akropolis schon von den Türken übernommen hatten, hörte die Jagd nach Antiken nicht auf. Der erste deutsche Kommandant, Christoph Neeser, schreibt in seinen Memoiren: “Als ich selbst einst in diesem Parthenon mich befand, kam Herr Pittakis (ein mit der Aufsicht betrauter Grieche) hilfesuchend und rufend zu mir, weil einige Offiziere einer amerikanischen Fregatte, welche in Piräus lag, daran waren, die herrlichen Ornamente des Erechtheions abzuschlagen und mit sich fortzunehmen... Aber so sehr Herr Pittakis, Roß (er war damals “Unterkonservator von Antiquitäten“ in Nauplia, ein Jahr später wurde er Oberkonservator in Athen) und ich diesen Zustand beklagten, so wenig schien er mehrere der eingewanderten Machthaber zu beunruhigen. Einer derselben erzählte mir schon in Nauplia als eine höchst ergötzliche Tagesneuigkeit, es habe kürzlich ein Brigg unter österreichischer Flagge an die bekanntlich jetzt unbewohnte Insel Delos angelegt, dreißig bis vierzig Mann ausgeschifft, welche, mit den nötigen Werkzeugen und Transportmitteln versehen, alles, was sie nur von Altertümern hätten finden können, auf ihr Schiff gebracht und mit sich fortgenommen hätten.“
(Wolf Seidl, a.a.O., S. 153/154)
Zu den Antikenjägern gehörten auch die deutschen Freunde Carl Freiherr Haller von Hallersleben und Otto Linkh. Ihnen lag jedoch an der Antike nicht weniger als an Antiken, sie hatten sich darauf beschränkt, nur in der Erde zu gegraben, und sie hatten sich ordnungsgemäß eine Grabungserlaubnis besorgt. Dass sie, um sich in den Besitz der berühmten Ägineten zu bringen, die wir heute in der Münchner Glyptothek bewundern können, nicht zimperlich vorgingen, haben sie selbst voller Stolz schriftlich festgehalten. Wir hören Jakob Linkh: 29. April 1811: “ Der Kopf der Minerva wurde heute vor unserer Ankunft gefunden. Während ich in Athen war, so negozierte die Insel über die Erlaubnis, uns graben zu lassen, und verlangte anfänglich 10.000 Piaster. Cockerell und Haller wollten nichts ohne uns tun und verschoben alle Unterhandlungen bis auf unsere Ankunft. Sie verlangten zuletzt bloß 1.000 Piaster.“ (W. Hautumm (Hg.), a.a.O., S. 82)
Schließlich wurde ein Kontrakt über 800 Piaster geschlossen. Das entsprach dem Materialwert der Skulpturen.
Dass die Funde heimlich zum kleinen Hafen Aghia Marina geschafft, von dort heimlich am Zoll vorbei über den Hafen Faliron - nicht Piräus - nach Athen und wiederum heimlich weiter auf die damals unter englischer Herrschaft stehende Insel Zante - heute Zakynthos - gebracht wurden, um schließlich auf Malta für 120.000 Mark an den bayrischen Thronfolger versteigert zu werden, steht auf einem anderen Blatt. Ca. 600 Mark hatte man für die Grabungserlaubnis ausgeben müssen.
Noch einträglicher war das Geschäft mit dem Fries des Apollontempels von Bassai. 1812 hatten sie dort zu graben begonnen. Zu Haller von Hallersleben und Linkh war nun auch Otto Magnus Baron von Stackelberg gestoßen, aus dessen Feder 1826 in Rom eine Veröffentlichung mit dem Titel “Der Apollontempel zu Bassai in Arkadien und die daselbst ausgegrabenen Bildwerke“ erscheint. Den Grund und Boden für die Grabungen erwarben sie für 600 - 800 Mark. Der Verkauf des Frieses nach England brachte 300.000 Mark ein. Zwar hatte sich der Pascha vertraglich die Hälfte der Funde ausbedungen und die Ausgräber waren auch durchaus willens, den Vertrag einzuhalten. Wie es dazu kam, dass sie trotzdem im Besitz aller Friesplatten bleiben durften, erzählt Baron so: “Als der Pascha die Anzeige des Erfolges der Nachgrabungen nebst einer Zeichnung von allen gefunden Bildwerken erhielt, hatte ein zuvorkommendes Gerücht schon die Reliefs von weißem, glänzenden Marmor in Statuen von purem Silber verwandelt und seine Erwartung aufs höchste gespannt. Zeichnungen genügten ihm daher keineswegs, er wollte sich mit eigenen Augen von der Wahrheit überzeugen, und auf sein ausdrückliches Verlangen musste die Hälfte der Bildwerke in seine Residenz Tripoli (Tripolis) geschaffen werden, obgleich die Schwierigkeit des Transports der gewichtigen Massen über hohe unwegsame Gebirge sie manchen Gefahren aussetzte. Dem Pascha selbst machte die Übersendung keine Freude. Beim Anblick der durchs Alter gebräunten Marmorfragmente in seinen Erwartungen herabgestimmt, fand er so wenig Gefallen an den Bildwerken, dass er, ohne das Dargestellte zu begreifen, sie unverzüglich zurückschickte; doch auf den möglichsten von der Kunstliebe der Franken zu ziehenden Vorteil bedacht, glaubte der Pascha, den Zweifel an seiner Kennerschaft dadurch zu entfernen, dass er beim Rücksenden der Antiken zugleich sein Erstaunen über die schöne Ausführung und die täuschend natürliche Darstellung - der Schildkröten berichten ließ. Dafür hatte er die Schildbewaffneten angesehen. Es konnte nun nicht mehr schwer halten, von Veli die Abtretung seiner Ansprüche auf die Bildwerke gegen eine mäßige Geldsumme zu erlangen“ (W. Hautumm, a.a.O., S.139/140)
Die Griechen und die Antike
Nun war es um das Verständnis der Griechen für die Antike nicht viel besser bestellt. Von den Hirten, die für die Grabung in Bassai angeheuert worden waren, berichtet von Stackelberg, sie hätten die Hellenen, mit deren Namen sie alles Helden- und Riesenmäßige bezeichneten, für Vorfahren der Franken, d.h. der Ausgräber, gehalten und sich so “die häufigen Besuche der reisenden Europäer“ erklärt „und den Wert, welche diese auf alle von jenen herrührenden Überbleibsel legen.“ (W. Hautumm, a.a.O., S. 128)
Rhomäer, Römer, genauer: römische Christen, nannten sich die Griechen damals selbst, im Gegensatz zu den Heiden, den Hellenen. Die Bayern waren es, die wie so vieles aus der Antike so auch den antiken Namen Hellenen wieder offiziell zu Ehren brachten und die Bürger Griechenlands so bezeichneten. Sie knüpften dabei an die Bewegung des Philhellenismus an, die für die Befreiung Griechenlands von der Türkenherrschaft gekämpft hatte.
Das Interesse an Inschriften erklärten sich die Griechen damit, dass, wenn nicht die Steine selbst Schatztruhen seien, so doch die Buchstaben auf Orte hinwiesen, an denen Schätze vergraben seien. (Karl Krumbacher, a.a.O., S. 235)
Natürlich gab es auch die für Antike schwärmenden Freiheitskämpfer. Einer von ihnen war Rigas Welestinlis (1757 - 1798); in einer vielstrophigen patriotischen Hymne beschwor er Leonidas, den Helden der Thermopylen, und fuhr fort (Strophe 35):
„Sie, die bewundernswerten,
Die Helden, groß an Zahl,
Sind ja doch unsere Ahnen.
Auf! Lasst sie uns nicht mahnen!
Die Zeit drängt, sie rufen uns wieder,
Ins Feuer, ihr tapferen Krieger!“
(zitiert nach: Karin und Giorgios Aridas (Hg.), a.a.O., S. 57)
Dem steht der erste frei gewählte griechische Präsident gegenüber, Johannes Graf Kapodostrias (1776 - 1831), dem das Diktum zugeschrieben wird, die Alten seien unruhige Köpfe gewesen, von denen die Neugriechen nichts Praktisches lernen könnten. In Korfu geboren, war er bis zum Staatssekretär im russischen Außenministerium aufgestiegen, bevor er sich in den Dienst der griechischen Sache stellte. Griechisch hat er nie richtig gelernt. Ein anderer Grieche, Andreas Mutoxidis, immerhin u.a. Direktor des ersten Antikenmuseums Griechenlands auf Aigina, verfluchte die Türken, „dass sie in Athen noch einen Stein auf dem anderen gelassen haben,: dann würde man doch nicht immer wieder von den alten Erinnerungen hören.“ (R. Baumstark, a.a.O., S. 133)
Jahrhunderte währende Fremdherrschaft - erst durch Lateiner, dann durch Türken - waren nicht spurlos an dem Volk vorübergegangen. Nur in den Klöstern war ein bescheidenes Maß an Bildung vermittelt worden, und natürlich in einer christlich-nationalen Ausprägung in Abgrenzung gegenüber den Ungläubigen aus West und Ost. Die antike Tradition war dabei überhaupt nicht präsent. Europa war fälschlich davon ausgegangen, die Griechen von 2000jähriger Fremdherrschaft zu befreien, als wenn die Byzantiner Fremde gewesen wären. Die Griechen träumten von der “Megali Idea“, der Wiederherstellung des byzantinischen Reiches mit Konstantinopel als Hauptstadt, ein Traum, aus dem sie erst in der Folge des ersten Weltkriegs jäh und grausam gerissen wurden. Und noch heute - behaupte ich - vermittelt sich griechische Identität eher über das orthodoxe Christentum als über das heidnische Altertum. Weder das Lateinische noch das Altgriechische spielt im heutigen Bildungssystem Griechenlands eine nennenswerte Rolle.
Viele Reisende des ausgehenden 18. und des beginnenden 19. Jahrhundert hatten nur Verachtung für die Menschen übrig, denen sie im Land begegneten: “Was mache ich mir denn aus diesem niederträchtigen Haufen moderner Sklaven, die mit ihrer Unwissenheit und Dummheit diesen erlauchten Boden besudeln? Sie sind für mich gar nicht vorhanden.“ (Ph. Bracken, a.a.O., S. 164)
Das schreibt 1799 der Engländer John Teddel.
Die Deutschen, geprägt durch das Bildungsgut der Klassik, sahen das nicht anders. Der Leutnant von Striebeck, der als Freiheitskämpfer nach Griechenland gekommen war, vertraut seinem Tagebuch seine bittere Enttäuschung an: “Die Bewohner selbst des neuen Hellas erschienen uns unkriegerisch, lässig, träge und gleichgültig nach morgenländischer Weise, die uns wenig zusagte [...]. Welche trüben und schmerzlichen Gefühle betrogener Erwartung mussten in uns sich regen, wenn wir in den Versammlungen des Volkes oder an öffentlichen Plätzen, statt streitfertiger Söhne des erwachten Landes, nur traurigen Gestalten begegneten, aus deren Mienen Unlust und Überdruss sprachen, die statt erwarteter Zeichen tiefen Abscheus nur eine Hinneigung zu dem Charakter und zu den Sitten ihrer Unterdrücker, der Türken, blicken ließen! Wie sehr widersprach der kränkende Zug von Gewinnsucht an den Toren Navarinos dem uns lieb gewordenen Gedanken an das alte, gastliche Pylos, an die Wiedergeburt eines klassischen Volkes! Selbst von dem äußern Gepräge des Mutes, das die alten Hellenen in den Perserkriegen so herrlich als Volkscharakter entwickelten, und von jener allgemeinen, den Einzelnen wie das Ganze ergreifenden, Bewegung, welche wir selbst in den deutschen Freiheitskämpfen erfahren und geteilt hatten, war auch nicht die geringste Spur in ihnen zu entdecken.“ (zitiert in: Regine Quack-Eusthadiades, a.a.O., S. 71)
Hölderlins Hyperion resümiert enttäuscht: “In der Tat! Es war ein außerordentliches Projekt, durch eine Räuberbande mein Elysium zu pflanzen.“ (a.a.O., S. 124)
Gleichsam ideologisch untermauert wurde diese negative Einschätzung von dem berühmt-berüchtigten Jakob Philipp Fallmerayer (1790-1861), Gymnasialprofessor und Mitglied der Münchener Akademie der Wissenschaften. 1830 erschien sein Buch: “Geschichte der Halbinsel Morea im Mittelalter“, in dem er die folgende These vertritt: “Denn auch nicht ein Tropfen echten und ungemischten Hellenenblutes fließet in den Adern der christlichen Bevölkerung des heutigen Griechenlands. Ein Sturm, dergleichen unser Geschlecht nur wenige betroffen, hat über die ganze Erdfläche zwischen dem Ister und dem innersten Winkel des peloponnesischen Eilands ein neues, mit dem großen Volksstamm der Slaven verbrüdertes Geschlecht von Bebauern ausgegossen. Und eine zweite, vielleicht nicht weniger wichtige Revolution durch Einwanderung der Albanier in Griechenland hat die Scenen der Vernichtung vollendet.“ (zitiert in: Karl Baedeker, a.a.O., S. XLVIII)
Fallmerayer hatte sich schon vorher durch eine Veröffentlichung mit dem Titel “Fragmente aus dem Orient“ den Ruf eines kompetenten Reiseschriftstellers erworben. Sein Werk über Morea war Ausdruck der Enttäuschung und diente zugleich als Bestätigung für alle, die ausgezogen waren, die Helden von Marathon und Salamis zu suchen, und sie nicht fanden.
Von Reisenden haben wir am Anfang gesprochen, seien es nun Abenteurer, Goldsucher, Archäologen, Philologen oder - nicht selten - das eine wie das andere. Da könnten wir leicht versucht sein, den Komfort des modernen Tourismus zu assoziieren. Weit gefehlt. Eine Exkursion ins Landesinnere wollte sorgfältig vorbereitet sein. Es galt, für Verpflegung und Nachtlager und gegen Schnaken und Ungeziefer Vorsorge zu treffen. Ein “”Handbuch für Reisende in den Orient“ von 1840 gibt folgende Ratschläge: “Jeder Reisende im Orient führt sein Bett oder mindestens eine gute Decke mit sich, welches um so nötiger erscheint, als man in diesen Ländern nicht einmal Stroh findet, um sich ein Lager zu bereiten. Man lässt sich daher in Athen eine gute Matratze mit kleinem Kopfpolster von Rosshaaren fertigen und kauft eine Decke dazu, welches alles dort vortrefflich zu haben ist. Ein Nachtsack oder lederner Ranzen enthält die unerlässliche Wäsche, einen Kleiderwechsel, und wird in die Matratze gepackt. Das Ganze steckt man in einen großen Sack von Wachsleinwand, und so ist man nach dem stärksten Regentage sicher, nachts wenigstens trocken zu schlafen. Eine gute Erfindung sind die Schragen, auf welche man die Matratze legt, um dem feuchten Boden und dem Ungeziefer weniger ausgesetzt zu sein. Sie sind ganz zusammenzulegen, und da ein Pferd zwei Matratzenpäcke trägt, so schnallt man diese zusammengelegten Bettstellen der Länge nach zwischen ihnen fest. Man tut gut, zum Schutze gegen die Schnaken Vorhänge mitzunehmen, die man ebenso leicht an Stäben über das Gesicht spannen kann. Ein zweites Pferd trägt die Körbe und Schläuche mit den Lebensmitteln; der Wein wird in hölzerne Feldflaschen oder in Flaschenkörben transportiert. Geschirre für Kaffee, Tee, Suppe, Teller, Becher, Kohlenpfannen, alles von Zinn, müssen gleich den Bestecken mitgenommen werden. Milch von Kühen uns selbst von Ziegen findet sich sehr selten; wer daher seinen Kaffee oder Schokolade gerne damit mischt, muss schon von europäischen Städten Crême de lait in Flaschen mitnehmen, der sich lange hält.“ (zitiert nach: FAZ vom 28.02.1991, Nr. 50, Seite R40)
Dass man in unseren Breiten nicht schonender mit den Monumenten der Vergangenheit umgegangen ist, wird leicht vergessen. Das römische Theater in Mainz, dessen Gewölbe im frühen Mittelalter (7./8. Jahrhundert) noch als Begräbnisstätte genutzt wurden, diente im 18. Jahrhundert als Steinbruch zum Bau der Zitadelle.
Die Holzpfosten der alten römischen Rheinbrücke überleben in Möbeln, zu denen man sie zu Beginn des vorigen Jahrhunderts verarbeitet hatte. Die - wenn auch rudimentäre - Erhaltung des Eichelsteins, des Drususdenkmals, verdanken wir nur der Tatsache, dass er als Wachturm Verwendung fand.
Das waren die Hinterlassenschaften der Römer, nicht die unserer eigener Vorfahren, mag man einwenden. Zu Unrecht, wenn man bedenkt, wie leichtfertig man nach dem 2. Weltkrieg bereit war, noch erhaltene historische Bausubstanz unserer Städte dem Moloch Verkehr zu opfern. Wollte man nicht allen Ernstes die Frankfurter Oper in die Luft sprengen? Es ist noch nicht lange her, dass die Amerikaner im Irak schneller und effektiver die Ölförderung sicherten als die Bestände der Museen und Bibliotheken.
Wir, die wir selbst im Glashaus sitzen, sollten uns hüten, auf andere Steine zu werfen.
Die Bayern und die Antike
Nun wurde also ein bayrischer Prinz, Otto, erster König von Griechenland. Da prallten Welten aufeinander.
“Es ist unsäglich niederdrückend, wenn man überall die ärgste Barbarei sieht, und darauf das ganze moderne Baierntum aufgepfropft. Wilde Gesichter in bairischer Uniform; und eine Wachparademusik, die mit ihren neuesten Opernmelodien ihr Schönes in Berlin und Potsdam hat, in Athen aber geradezu empörend ist.“ (a.a.O., S. 6)
So empfindet es 1852 Hermann Hettner.
Johann Jakob Bachofen, der mit seiner Theorie über das Matriarchat Aufsehen erregte, bemerkt, in seinem Bericht über eine Griechenlandreise im Jahre 1851 folgendes über das griechische Militär: “Sind das die Nachkommen der Helden des Freiheitskrieges, diese unheimlichen Gestalten, denen die schmutzige, abgetragene blaue Uniform des bayerischen Soldaten so ganz schlecht steht? Aus dem geschenkten fremden Anzug schaut der Bettelstand noch mehr heraus. Aber das ist dennoch im kleinen das Bild des Zustands im ganzen Königreich. Über einem schönen Körper ein fremder Lappen, einem Volk von Kraft und Ungetüm die bayerische Bedientenlivree umgehängt, Zustände der rohesten Art im Geschmacke der verkommenen Monarchie des 19. Jahrhunderts ausgestattet, das ist das heutige bayerische Griechenland, ein ungeheurer Widerspruch in sich selbst, und darum lächerlich und abstoßend, wo immer es in diesem entlehnten Gewande auftritt.“ (zitiert nach Hans Hallmann, a.a.O., S. 54,55)
Nun musste alles das rasch nachgeholt werden, was sich das übrige Europa in Renaissance und Klassik angeeignet hatte. Hellenen hießen die Griechen nun wieder, Drachmen die Münzen, und alle sollten die Sprache der alten Griechen lernen: Wieso lernen? Sprach sie nicht jedermann und jede Frau? Friedrich Theodor Vischer kommt 1840 in Griechenland an, und als ein Grieche auf eine Frage mit “malista - ja“ antwortet, bricht es begeistert aus ihm heraus: “Was spricht der Mensch? Welche Sprache ist dies? Kommt das nicht ebenso in Herodot und Plato, in Sophokles (vor) - hat er aus Buttmanns Grammatik, hat er aus Jakobs Attika Griechisch gelernt? Hat er in Jena, in Kiel, in Greifswalde studiert? Nein, nein, es ist seine Sprache, er spricht die Sprache des Plato, des Sophokles, sie lebt noch; Griechenland ist kein bloßes Phantasieland, wie ich heimlich fürchtete, ich bin in Griechenland.“ (zitiert in: W. Hautumm, a.a.O., S. 197)
Was wusste Vischer, was wussten die Reisenden von dem Land, in das sie kamen, von den Menschen, die in ihm lebten? Nichts. Entzücken löste nur aus, was antik war oder was an die Antike erinnerte. Woher hätte man es aber auch wissen sollen? Was gab es denn außer ein paar sehr subjektiven Reisebeschreibungen aus jüngster Zeit?
Wie verhielt es sich mit der Sprache? Sie erhielt zwar noch sehr viele alte Wörter, hatte sich aber seit der Antike erheblich weiterentwickelt: Nicht nur die Aussprache hatte sich geändert, sondern auch die Grammatik, und in das Vokabular waren zahlreiche Fremdwörter aus dem Slawischen, Türkischen, Italienischen eingedrungen. Keiner hätte sich mit seinen Altgriechischkenntnissen mit einem einfachen Griechen unterhalten können. Leichter wäre es ihm vermutlich gefallen, sich mit einem Papas oder gar einem Bischof zu verständigen. Denn gerade in der Kirche war eine Hochsprache gepflegt worden.
Im 1. Jahrhundert v. Chr. hatte es eine Bewegung gegeben, die sich rückgewandt an der Klassik orientierte und die von Platon, Xenophon und anderen gepflegte Sprache zum Maßstab erhoben hatte. Es war gelungen, sie über die Jahrhunderte hinweg mehr oder weniger unverändert “rein“ zu erhalten.
“Die Priester, selbst unwissend, waren die einzigen Lehrer der Nation, die Kirchen die einzigen Schulen derselben“ schreibt Alexandros Soutzo in der “Geschichte der griechischen Revolution“ (Berlin 1830, S. 3).
Als es nun galt, eine verbindliche Sprache für den neuen Staat zu etablieren, entschied man sich für diese reine Sprache, die Katharewusa, und entfachte damit einen Streit, der erst 1976 beendet worden ist, und zwar zu Gunsten der Volkssprache, der Dimotiki.
Karl Krumbacher beschreibt 1886 die Situation so: “In wissenschaftlichen Werken, in den Zeitungen, in der Kammer und in allen offiziellen Kundgebungen wird ein archaisierendes Idiom verwendet, das trotz aller gegenteiligen Versicherungen als eine künstliche, unlebendige Schöpfung bezeichnet werden muss... Unter diesem mumienhaften Gebilde blüht eine nach inneren Gesetzen aus dem Hellenischen hervorgewachsene Sprache, die auf der breiten Basis des Volkes selbst ruht und allein wirkliches Leben besitzt.“ (a.a.O., S. XXII f.)
Die Sprache der Alten also mussten die Griechen nun lernen, damit sie, wenn sie schon nicht waren wie die alten Griechen, so doch wenigstens so sprachen. Und lesen mussten sie sie und studieren. Ihre Abneigung gegen das Lateinische, “welches sie für überdrüssig, ja für eine Brücke zum Papismus hielten, da man in der Levante die römischen Katholiken als Lateiner zu bezeichnen pflegt,“ /L. Ross, a.a.O., S. 71) half ihnen nichts: Von nun an stand es auf dem Lehrplan.
Gymnasien, natürlich humanistische, wurden gegründet, obwohl es an Volkschulen allenthalben mangelte. Eine Universität durfte nicht fehlen, Vorbild der Gründung war Göttingen; 1837 wurde sie als „Otto-Universität“ in einem Haus am nördlichen Abhang der Akropolis feierlich eröffnet. Die Zeremonie schildert Ross. Sie zeigt noch einmal die Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität.
“Ohne eine festliche Einweihung konnte es nicht abgehen; der erhabene Gründer der Universität, der ihr seinen königlichen Namen gegeben hatte, bestimmte den Tag dazu. Unter unseren Kollegen war ein geschickter alter Arzt und sehr gewandter, wenn auch nicht immer geschmackvoller Hellenist, Dr. Georgiades Levkias, der lange in Bukarest, Wien und Paris gelebt und die Einrichtungen des westlichen Europa, selbst den guten alten deutschen Zopf sehr lieb gewonnen hatte. Er sollte die Festrede halten und ließ es sich nicht nehmen, wie unpassend dies auch in Athen sein mochte, dabei in dem traditionellen akademischen Kostüme des vorigen Jahrhunderts zu erscheinen: in Schuhen und seidenen Strümpfen, kurzen schwarzen Modesten, einen Degen an der Seite und einen dreieckigen Klapphut unter dem Arme. Der alte Herr mit der großen, meistens etwas weinseligen Nase sah schon an für sich etwas lächerlich aus. Für den König wurde an einem Ende des Saals, wenn ich das bescheidene Zimmer so nennen darf, eine Erhöhung mit einigen Stufen errichtet, auf welcher der König seinen Stand nahm, aber aufrecht blieb; zur Seite war ein Katheder für den Redner, hinter welchem wir übrigen Professoren, die ersten wenigen Studenten und einige Zuschauer standen. Levkias redete nach seiner Art mit großem Pathos; als er aber vollends in seiner Rede an eine Stelle kam, in welcher er uns, seine Kollegen, aufforderte, Schild an Schild eine Testudo zu bilden (synaspismon piisamenos) gegen die Unwissenheit der Barbarei, und dabei in dramatischer Haltung den linken Arm mit dem Hute vorstreckte, während er sich mit dem Körper hinter dem Rednerpulte zusammenkauerte: da brach in unseren Reihen, trotz der ernsten Bedeutung des Augenblicks, ein unauslöschliches Lachen aus, und der junge König, allen Blicken freigestellt, hatte die größte Mühe, seine Gesichtszüge zu beherrschen und halben Ernst zu bewahren. So verlief die Gründung der Otto-Universität.“ (L. Ross, a.a.O., S. 107/108)
Eingeschrieben war noch ein halbes Jahrhundert später “eine bedenklich große Zahl von jungen Leuten..., welche von der auf einer Universität vorauszusetzenden Stufe allgemeiner Bildung durch eine zu große Kluft getrennt sind, als dass sie den gelehrten Fächern mit dem notwendigen Verständnis folgen könnten.“ (K. Krummbacher, a.a.O., S. 44)
Der Lehrbetrieb verlief so, dass “die wichtigsten Tatsachen des Gegenstandes“ in der “halb altgriechischen, geschraubten Diktion“ diktiert wurden, um anschließend “in der gewöhnlichen neugriechischen Umgangssprache erläutert zu werden.“ (K. Krummbacher, a.a.O., S. 46/47)
Wie in der Sprache und der Bildung die alten Griechen wieder in ihre Rechte eingesetzt werden, so auch in den archäologischen Stätten: Sie werden von allem, was sie seit der Römerzeit verändert hat, was sich ihnen angelagert, was um sie herum gewachsen ist, befreit, “gereinigt“, könnte man in Anlehnung an die Sprachpolitik sagen. Manche bedauern, dass die Archäologen “in ihrem Eifer... alle malerischen Zutaten des Mittelalters zerstören...“ (L. Ross, a.a.O., S. 84).
Und natürlich wird die Antike auch stilbildend für die Gestaltung des neuen Athen: die Schauseite der Akademie des Dänen Theophil Hansen nimmt für die ionischen Säulen des Portals Maß an denen der Propyläen, Muster der dorischen Fassade der Nationalbibliothek Ernst Zillers ist das Hephaisteion. Der Plan des Berliner Architekten Karl Friedrich von Schinkel, das Plateau der Akropolis mit einer Schlossanlage zu überziehen und die antiken Bauwerke in sie zu integrieren, ist nicht ausgeführt worden. Leider, sagen die einen, zum Glück sagen die anderen. Nichts sprach dagegen, die Antike zu imitieren, alles, ihre vermeintliche Originalität zu beeinträchtigen.
Die gebildeten Humanisten formen das neue Griechenland nach dem Bild, das sie sich von dem alten machen, katapultieren die Griechen aus dem Mittelalter in das 19. Jahrhundert und aus der Türkei nach Europa, aus dem Orient in den Okzident, wo sie noch immer nicht recht angekommen sind. Denn wenn ein Grieche nach Deutschland, Frankreich, Italien fliegt, dann, so sagt er, fliegt er nach Europa.
Wer übrigens selbst die griechische Nationalfahne als bayrisches Erbe vindizieren möchte, der irrt. Der erste frei gewählte griechische Präsident, Johannes Graf Kapodistrias, hatte sie 1822 eingeführt. Sie zeigt das Wappen des byzantinischen Kaisers Nikephoros Phokas, der von 963 bis 969 regierte.
Und was suchen wir Bildungsbürger des 21. Jahrhunderts in Griechenland anderes als die Antike? Interessieren uns Reisende die heutigen Menschen und ihre Probleme? Was wissen wir von ihrer Sprache, ihrer Kultur, ihrer Geschichte?
Der Schreibende fühlt sich mitschuldig. Sein Reiseführer spiegelt das Land - worin? Natürlich in antiken Quellen.
Aber seien wir nicht ungerecht: Es ist nicht selbstverständlich, dass sich das alte Athen inmitten des neuen erhalten hat. Es war das Wer der Bayern, bei der Stadtplanung auf die antiken Bauten Rücksicht zu nehmen und so das zu ermöglichen, was anlässlich der olympischen Spiele 2004 realisiert wurde: Ein archäologischer Park vom Stadion bis zum Kerameikos.